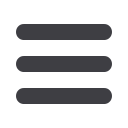

34
35
blick zurück
|
looking back
blick zurück
|
looking back
Engelberg und sein Benediktinerkloster – oder
das Kloster und sein Tal? Seit fast neun Jahrhun-
derten bilden beide eine untrennbare Einheit.
Nachdem 1120 das Kloster gegründet worden war,
begannen die Mönche, das wilde und abgelegene
Tal bewohnbar zu machen. Zugleich sorgten sie
dafür, dass das Tal besiedelt wurde. Eine
Besonderheit Engelbergs war dabei, dass das
Kloster über das Hochtal die Herrschaftsrechte
besass. Somit bildete sich ein eigenständiges
Staatswesen heraus – die Freie Herrschaft
Engelberg.
Unter der Leitung des
Abtes (Vorsteher) führte das
Kloster die Geschicke der Tal-
schaft. Allerdings sahen sich
die Bewohner des Tals schon
bald nicht mehr als reine
Untertanen, sondern traten
selbstbewusst als Talleute auf, die ein Mitspra-
cherecht forderten. Bereits 1422 konnten sie eini-
ge Erfolge erzielen. In der Folge entwickelte sich
zwischen den Mönchen und den Talleuten ein
bemerkenswertes Miteinander, indem sie wäh-
rend der nächsten knapp 400 Jahre die Rechtsset-
zung und Rechtsprechung gemeinsam ausübten.
Von zentraler Bedeutung war dabei das Talge-
richt, das für das tägliche Leben prägend war.
Ein Höhepunkt in der Beziehung zwischen
Kloster und Tal bildete die Amtszeit des Abtes
Barnabas Bürki (im Amt 1505-1546). Mitten im
Zeitalter der Reformationskonflikte gelang es
ihm, das Tal zu reorganisieren. Neue Gesetze
wurden erlassen, die Klosterschule gestärkt,
Alpstreite mit den Nachbarn geschlichtet und
das Flussbett der Engelberger Aa verlegt. Somit
konnten die regelmässigen Hochwasser zurück-
gedämmt werden. Schwieriger war dagegen das
Verhältnis mit Abt Jakob Benedikt Sigrist (im
Amt 1603-1619). Als energischer Reformer geriet
er mit den Talleuten und den umliegenden Kan-
tonen in Konflikt. Sein Versuch, Engelberg als
absolutistischen Klosterstaat zu führen, schei-
terte. Anschliessend beruhigte sich die Situation
wieder. Der Klosterbrand 1729 schweisste Kloster
und Talleute wieder enger zusammen, sodass
der Wiederaufbau gemeinsam gemeistert wur-
de. Das Kloster war dabei für die Bevölkerung
nicht nur die politische Führungsfigur, son-
dern sorgte sich auch um die wirtschaftlichen
Bedürfnisse. Unter Abt Leodegar Salzmann (im
Amt 1769-1798) wurde etwa die Seidenkämmlerei
eingeführt, um den Talleuten weitere Verdienst-
möglichkeiten zu schaffen.
Mit dem Einmarsch
der französischen Revoluti-
onstruppen 1798 änderte sich
allerdings die Ausgangslage.
Das Kloster erklärte sich bereit,
auf seine Herrschaftsrechte
zu verzichten und übergab den Talleuten die
Souveränitätsrechte. Damit hörte der Kleinstaat
auf zu existieren. Nach einigen Wirren schlossen
sich Kloster und Tal 1815 dem Kanton Obwalden
an. Dank ausgehandelter Sonderrechte und der
geographischen Distanz zum Kanton konnte
Engelberg eine gewisse Eigenständigkeit bewah-
ren. In der Folge zeigte sich das Kloster weiterhin
als enger Partner der Talbevölkerung. Es küm-
merte sich um arme Talleute ebenso wie um die
Förderung des Tourismus. Sei es beim Bau neuer
Hotels, der Eisenbahn nach Engelberg oder beim
Bau von Bergbahnen: Als Liegenschaftseigen-
tümer oder gar Aktionär unterstützte es diese
Bestrebungen. Mit der Stifts- und Sekundar-
schule förderte es die Bildung im Tal. Ein Einsatz,
der von der Talbevölkerung geschätzt wird und
zeigt, dass die enge Bindung auch im 21. Jahr-
hundert weiterhin besteht und gepflegt wird.
Eineuntrennbare Einheit
One big Abbey family
Text: Mike Bacher; Fotos: Engelberg-Titlis
Auch heute besteht eine wichtige
Bindung zwischen Kloster und Tal.

















