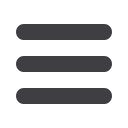

Nachhaltiger
Zeitgeist
Vor über 300 Jahren wurde der Begriff
Nachhaltigkeit geprägt. Was damals ein
regionales Problem behandelte, hat sich
zu einem globalen Konzept entwickelt.
Das hatte sich Hans Carl von
Carlowitz wohl nicht in sei-
nen kühnsten Träumen ausge-
malt, als er 1713, also vor über
300 Jahren, sein inzwischen
berühmt gewordenes Werk
Sylvicultura Oeconomica veröf-
fentlichte. Darin prägte der Ober-
berghauptmann am kursäch
sischen Hof in Freiberg, Sachsen,
den Begriff der Nachhaltigkeit.
Kernthese und gleichzeitig
auch Forderung an alle verant-
wortlichen gesellschaftlichen
Kräfte seiner Zeit war, dass künf-
tig nur noch so viel Holz ein-
geschlagen werden sollte, wie
auch wieder aufgeforstet wer-
den konnte. Doch wie kam er zu
dieser Forderung? Durch exzessi-
ves Abholzen waren die Waldbe-
stände in Sachsen und weiten Tei-
len des damaligen Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher Nation
nicht nur dramatisch dezimiert,
sondern geradezu im Bestand
bedroht. Noch schlimmer war
aus den Augen der Zeitgenossen,
dass damit die Schlüsselindustrie
des Landes, der Bergbau selbst,
bedroht war. Denn vor allem die-
ser war auf die ständig verfüg-
bare Energiequelle und das Bau-
material Holz angewiesen. Eine
Holzverknappung hätte den Nie-
dergang des Bergbaus bedeutet.
Nicht von ungefähr war
Hans Carl von Carlowitz Ober-
berghauptmann und stammte
nicht, wie manchmal irrtümlich
angenommen, aus der Forst-
wirtschaft. Dennoch: Gerade in
der Forstwirtschaft setzte sich
das Prinzip des nachhaltigen
Handels fortan mehr und mehr
durch.
Außerhalb der Forstwirt-
schaft erlangte der Begriff erst
in den 1970er Jahren an Be-
deutung. Anlass gab die Ver-
öffentlichung des Buches „Die
Grenzen des Wachstums“ 1972
durch den Club of Rome, in dem
die Endlichkeit der Rohstoffe
beschrieben und damit auch
das Ende eines grenzenlosen
Wachstums prophezeit wurde.
Heute sind die Thesen der Pu-
blikation weitgehend wieder-
legt. Insbesondere die Progno-
sen über die Endlichkeit fossiler
Brennstoffe haben sich als weit
übertrieben herausgestellt und
wurden immer wieder korrigiert
-- ein deutlicher Hinweis darauf,
wie notwendig es ist Prognosen
ständig kontrollieren und auf ih-
ren politischen Gehalt hin zu hin-
terfragen.
Dennoch hat der Experten-
zirkel dazu beigetragen, dass
Nachhaltigkeit zu dem Begriff
wurde, mit dem ein verantwor-
tungsvoller „nachhaltiger“ Um-
gang mit den Ressourcen der
Erde gefordert wurde.
Blieb die Forderung einer
nachhaltigen Forstwirtschaft
im 18. Jahrhundert auf einzelne
Länder begrenzt, erhielt die Pro-
phezeiung der Publikation des
Club of Rome also globale, oder
doch zumindest auf die indust-
rialisierte westliche Welt bezo-
gene, Bedeutung. Das Versiegen
der Rohstoffe, insbesondere des
Erdöls, hätte in der Tat für die In-
dustrienationen ähnlich apoka-
lyptische Dimensionen gehabt
wie das Fehlen des Rohstoffes
Holz als Energiequelle für den
sächsischen Bergbau im 18.
Jahrhundert.
Wie ein zusätzliches Fanal
wirkte vor diesem Hintergrund
die Ölkrise nur ein Jahr nach den
Analysen des Club of Rome und
den dadurch verursachten Sonn-
tagsfahrverboten.
Erstmals wurde damals
Nachhaltigkeit in seiner erwei-
terten Bedeutung eines „Zustand
des globalen Gleichgewichts“
verstanden.
Eingang fand der Begriff auch
1974 in ein Dokument des ökume-
nischen Rates der Kirchen und
der Definition eines neuen sozi-
alethischen Leitbildes, wodurch
sich die Bedeutung auch auf den
sozialen und ethischen Bereich
ausdehnte.
Enormen Schub erhielt das
Konzept der nachhaltigen Ent-
wicklung 1992 durch die Umwelt-
konferenz in Rio de Janeiro, wo
mit der Agenda 21 ein weltweites
Aktionsprogramm verabschiedet
wurde mit dem Ziel eines weltweit
verbesserten Umweltschutzes
und der nachhaltigen Nutzung
der begrenzten Ressourcen. In-
zwischen gibt es auf nationaler
und internationaler Ebene eine
unüberschaubare Anzahl von
Gremien, Institutionen und Orga-
nisationen, die sich mit Nachhal-
tigkeitskonzepten beschäftigen.
Ebenso unübersichtlich und viel-
fältig sind die Definitionen von
Nachhaltigkeit geworden.
In den Vordergrund gerückt
werden jedoch überwiegend drei
Kriterien:
•
‚die ökologische Nachhaltig-
keit mit Klimaschutz, Arten-
Nachhaltigkeit
Globales Konzept
38
3|2016
















