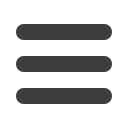

JURISPRUDENCE
82
forum
poenale
2/2008
Absichten oder Zwecke eines staatlichen Eingriffs erst bei
der Beurteilung der Legitimität einer existenten gesetzlichen
Eingriffsermächtigung einzubeziehen sind, von deren Schaf
fung der Staat jedoch nicht dispensiert wird. Diese gesetzli
che Konzeption würde unterlaufen, wenn bereits die An
wendbarkeit der Konventionsrechte an eine auf die Rolle
von «Täter» und Opfer zugeschnittene Zurechnungsdog
matik gebunden würde, die dem «Täter» den Schutz des
Art. 8 EMRK zugunsten allfälliger Opferinteressen systema
tisch vorenthält. Abgesehen davon, dass diese Rollenvertei
lung mit der Unschuldsvermutung des Art. 6 Abs. 2 EMRK
unvereinbar ist, würde die Grenze zwischen staatlichem Ein
griff und privater Beeinträchtigung nicht mehr nach der In
tensität der staatlichen Einflussnahme bestimmt, sondern
danach, welchem Zweck die jeweilige Handlung dient. Der
Staat wäre von den für hoheitliches Handeln geltenden Bin
dungen durch die Qualifikation der Massnahme als «pri
vat» a priori freigestellt, solange es «um eine gute Sache
geht» und das unmittelbare Geschehen in den Händen ei
ner Privatperson liegt. Ein solcher Zurechnungsansatz wi
derspricht der Systematik des Art. 8 EMRK – und er steht
darüber hinaus einer rechtsstaatswidrigen Aufgabe gesetz
licher Eingriffsvoraussetzungen für ausgewählte Fallgestal
tungen gleich.
Klarzustellen bleibt noch, dass der hilfsbedürftige Bür
ger, anders als es die niederländische Regierung glauben ma
chen will (§ 47; vgl. Sondervotum von Judge Palm zu
EGMR,
M.M. v. the Netherlands
; Sondervotum von Judge
Myjer, Ziff. 2), durch die Zurechnungsdogmatik des EGMR
mitnichten schutzlos gestellt ist. Die Haltung des EGMR
zwingt die Konventionsstaaten lediglich dazu, ihre Gesetz
gebungsaufgaben im Interesse ihrer Bürger angemessen zu
erfüllen. Ein Eingriff in Art. 8 EMRK ist einem Staat näm
lich keineswegs per se untersagt, er muss nur durch das er
forderliche Medium einer verhältnismässigen gesetzlichen
Grundlage vermittelt sein (vgl. §§ 50 ff.). Wenn es also aus
staatlicher Sicht geboten erscheint, dem schutzbedürftigen
Bürger unter bestimmten Umständen staatliche Hilfe bei der
Herstellung technischer Aufzeichnungen zu leisten, so steht
der konventionskonformen Umsetzung dieses Anliegens
nicht mehr und nicht weniger im Wege als die Untätigkeit
der Legislative: Die Vertragsstaaten haben es – auch dies ver
deutlicht dieser Entscheid – selbst in der Hand, unerträglich
erscheinende Auswirkungen der Strassburger Rechtspre
chung durch eine den Anforderungen des Art. 8 Abs. 2
EMRK gerecht werdende Erweiterung der innerstaatlichen
Eingriffskompetenzen zu beseitigen.
Assessorin iur. Gunhild Godenzi LL.M.
n
2. Strafverfahrensrecht
Procédure pénale
Nr. 17
Bundesgericht, I. öffentlich-rechtliche Abteilung,
Urteil vom 24. September 2007 i.S. X. gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg,
Kantonsgericht Freiburg – 1P.51/2007
Art. 7 Abs. 4 BÜPF, Art. 73 StPO/FR: Beweisverwertungsverbot,
GPS-Standortüberwachungen von Motorfahrzeugen.
GPS-Standortüberwachungen von Motorfahrzeugen im öffentli
chen Raum fallen nicht unter den limitierten Geltungsbereich des
BÜPF, Art. 7 Abs. 4 BÜPF ist hier nicht anwendbar. (E.3.4 und
3.5). Die materiellen Voraussetzungen für die Anordnung und Be
willigung einer solchen Überwachung durch den zuständigen Un
tersuchungsrichter bzw. das Zwangsmassnahmengericht wären
grundsätzlich erfüllt gewesen (E.3.5.1). Die Zulassung des formell
gesetzwidrig erlangten Beweismittels bestimmt sich daher nach ei
ner Interessenabwägung, die vorliegend zugunsten der Verwert
barkeit des Beweismittels ausgeht (E.3.5). Allerdings werden sich
die kantonalen Ermittlungsbehörden auch bei der GPS-Überwa
chung von Fahrzeugen hinfort an die einschlägigen prozessualen
Vorschriften halten müssen (E.3.5.6). (Regeste der Schriftlei
tung)
Art. 7 al. 4 LSCPT, art. 73 CPP/FR: interdiction d’utiliser une preu-
ve obtenue illégalement, surveillances par GPS de la position de
véhicules à moteur.
Les surveillances par GPS de la position de véhicules à moteur
sur le domaine public ne tombent pas dans le champ d’applica
tion limité de la LSCPT; l’art. 7 al. 4 LSCPT n’est pas applicable
(c.3.4 et 3.5). Les conditions matérielles pour ordonner et autori
ser une telle surveillance par le juge d’instruction resp. le tribunal
des mesures de contrainte auraient été remplies quant au princi
pe (c.3.5.1). La recevabilité du moyen de preuve obtenu illégale
ment d’un point de vue formel se détermine donc d’après une pe
sée des intérêts qui, en l’espèce, penche en faveur de l’exploitation
du moyen de preuve (c.3.5). Toutefois, les autorités cantonales de
poursuite devront désormais s’en tenir aux prescriptions de pro
cédure topiques également pour la surveillance par GPS de véhi
cules à moteur (c.3.5.6). (Résumé de la rédaction)
Art. 7 cpv. 4 LSCPT, art. 73 CPP/FR: divieto di utilizzare una pro-
va acquisita illegittimamente, monitoraggi di veicoli a motore
mediante GPS.
I monitoraggi mediante GPS dei veicoli a motore su aree pubbli
che non ricadono nel campo d’applicazione limitato della LSCPT;
nella fattispecie, l’art. 7 cpv. 4 LSCPT non è applicabile (consid.
3.4 e 3.5). I requisiti materiali richiesti affinché il giudice istrut
tore competente o il giudice dei provvedimenti coercitivi potesse
ordinare ed autorizzare tale monitoraggio, sarebbero stati in li
nea di massima adempiuti (consid. 3.5.1). L’ammissibilità di mez
zi di prova formalmente acquisiti in modo illegale si determina di
conseguenza sulla base di una ponderazione degli interessi che,














