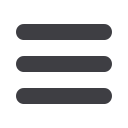

und nicht therapeutische Themen, ist zwar
der Apothekenmitarbeiter der Fachmann
und kann und sollte seinen Standpunkt
auch selbstbewusst vertreten, allerdings
sollte man der Argumentation des Arztes
gegenüber aufgeschlossen sein und seine
Erfahrungen und Wünsche an das Rezep-
turarzneimittel berücksichtigen.
Die häufigsten rezepturspezifischen
Gründe für die Kontaktaufnahme
DieAnlässeder Kontaktaufnahmeder Apo-
theke mit der Arztpraxis sind zum großen
Teil administrativer Natur, zum Beispiel bei
Formfehlern auf den Rezepten oder Nicht-
verfügbarkeit des verordneten Arzneimit-
tels. Deutlich weniger wird der Kontakt bei
pharmazeutischen Themen gesucht. Bei
Rezepturverordnungen sind die folgenden
Gründe sehr häufig der Anlass.
Fehlende Gebrauchsanweisung
Einer der häufigsten Gründe für ärztliche
Rücksprache bei Rezepturarzneimitteln
ist die fehlende Gebrauchsanweisung.
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 der Arzneimittel-Ver-
schreibungsverordnung (AMVV) muss bei
Arzneimitteln, die in der Apotheke herge-
stellt werden, die Verschreibung eine Ge-
brauchsanweisung enthalten. Nur so kann
in der Apotheke die Plausibilitätsprüfung
in Bezug auf die Dosierung und die Ap-
plikationsart durchgeführt werden. Es ist
auch nicht immer sichergestellt, dass der
Patient die mündliche Anweisung des Arz-
tes richtig verstanden und behalten hat.
Für die korrekte Angabe der Gebrauchsan-
weisung nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 ApBetrO ist
die Kenntnis der ärztlichen Anweisung un-
erlässlich. Die Ergänzung durch den Apo-
theker ist seit der Neufassung des § 3 des
Rahmenvertrags über die Arzneimittelver-
sorgung nach § 129 Abs. 2 SGB V erlaubt.
Demnach darf der Apotheker nach Abs. 1
Nr. 3 und Nr. 4c die Gebrauchsanweisung
nach Rücksprache mit dem Arzt auf dem
Verordnungsblatt nachtragen und mit
seiner Unterschrift bestätigen. Trotzdem
muss er natürlich im Vorfeld die fehlen-
den Angaben in der Praxis erfragen. Die
Gebrauchsanweisung sollte idealerweise
genaue Angaben
• zur Anwendungsart bzw. Lokalisation,
• zu Dosierung, Anwendungszeitpunkt
und -häufigkeit und
• zur Behandlungsdauer machen.
9
Hilfreich kann ein Formblatt für lokal an-
gewendete Rezepturarzneimittel sein,
welches vomArzt ausgefüllt und demPati-
enten mitgegeben wird (Abb. 3). Je poten-
ter das Rezepturarzneimittel ist, desto ge-
nauer sollte die Gebrauchsanweisung sein.
Bei unkritischen Basistherapeutika kann
diese natürlich auch kürzer ausfallen.
5
Obsolete oder bedenkliche Stoffe
Wie oben bereits erwähnt, stellt sich bei
der Verordnung obsoleter und umstritte-
ner Wirk- und Hilfsstoffe die Frage, ob es
eine Rezepturalternative gibt, die aktu-
ellen Therapiestandards entspricht. Zu-
mindest sollte der Arzt über die Tatsache
informiert werden, dass die Wirkstoffe
beziehungsweise die Zubereitung nicht
mehr dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft entsprechen. Dann entscheidet der
Arzt im Rahmen seiner Therapiefreiheit
MUSTERVORLAGEN
Die Mustervorlagen für die Arzt-Kom-
munikation finden Sie im DAC/NRF
auf der beigelegten CD-ROM im
Loseblattwerk oder unter der Rubrik
„Tools“ bei der digitalen Version und
online.
Gebrauchsanweisung
für Rezepturarzneimittel
Patient:
Datum:
Rp.-Bezeichnung:
Wo genau wie anwenden?
Wann/wie oft anwenden?
Wie lange behandeln?
Sonstige Anmerkungen:
ABBILDUNG 3:
Gebrauchsanweisung für dermatologische Arzneimittel
18
/ AKWL Fortbildung Aktuell – Das Journal
SINNVOLLER EINSATZ VON REZEPTURARZNEIMITTELN
















