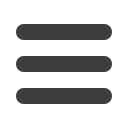

115
RECHTSPRECHUNG
2/2008
forum
poenale
schweizerischem Strafrecht grundsätzlich strafbar wäre (in
kriminiertes Tötungsdelikt vom 30. April 1994). Eine allfäl
lige Ausdehnung des Anklagesachverhaltes wäre nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der schweizerischen Behörden
zulässig (Art. 14 Ziff. 1 lit. a EAUe; vgl. BGE 131 II 235 E.
2.14 S. 243 f.).
[…]
Bemerkungen:
I. In Erw. 2 kommt das BGer zum Schluss, dass die Sachver
haltsdarstellung betreffend den Vorwurf, der Beschwerde
führer sei am 30.2.1994 als Mittäter oder Anstifter an ei
nem Tötungsdelikt beteiligt gewesen, (im Unterschied zu
anderen Vorhalten) den Anforderungen von Art. 12 EAUe
genügen würde. Die entsprechende Prüfung, ob die im Aus
lieferungsersuchen angegebenen Sachverhaltselemente eine
Subsumtion unter einen Straftatbestand nach schweizeri
schem Recht ermöglicht, erfolgt nach den üblichen forma
len Grundsätzen, die eine Prüfung der Täterschaft grund
sätzlich nicht zulässt. Die entsprechenden Ausführungen
überzeugen und geben zu keinem Kommentar Anlass.
II. Bemerkenswert sind die (teilweise nicht in der Ent
scheidsammlung publizierten) Ausführungen zum Einwand,
bei den inkriminierten Taten handle es sich um
politische De-
likte
(Erw. 3). Der Prüfung dieser Einrede wird die Unter
scheidung des absolut und des relativ politischen Delikts vo
rangestellt. Nachdem die erste Kategorie in casu bereits
aufgrund der Definition «Straftaten, die sich ausschliesslich
gegen die soziale und politische Staatsordnung richten» von
vorherein ausser Betracht fällt, wird der unbestimmte Rechts
begriff des relativ politischen Delikts zunächst abstrakt – im
Sinne der sich über Jahrzehnte entwickelten Rechtsprechung
– ausgelegt. Nach der sog.
Prädominanztheorie
muss der Tat
vorwiegend politischer Charakter zukommen.Vereinfachend
ausgedrückt setzt dies voraus, dass Tatmotive, Ziele und Um
stände vorherrschend politisch erscheinen (enger Zusammen
hang mit einem Machtkampf im Staat). Zudem müssen die
Rechtsgüterverletzungen im Hinblick auf die angestrebten
legitimen Ziele verhältnismässig sein und Letztere müssen
dergestalt sein, dass die Tat einigermassen verständlich er
scheint (Erw. 3.2). Danach wird diese abstrakte Auslegung
unter anderem mit der aus dem Europäischen Terrorismus
übereinkommen (EÜBT) entnommenen Regel konkretisiert,
dass bei schweren Gewaltverbrechen in der Regel der politi
sche Charakter verneint wird (Art. 2 Ziff. 1 EÜBT). Als Aus
nahmen werden Bürgerkriegsverhältnisse und der sog. Ty
rannenmord als
ultima ratio
für die Erreichung humanitärer
Ziele erwähnt (Erw. 3.3). Anzumerken ist, dass die sich über
Jahrzehnte entwickelte bundesgerichtliche Praxis zum poli
tischen Delikt auch international grosse Beachtung in Lehre
und Rechtsprechung gefunden hat (vgl. Gilbert, Aspects of
Extradition Law, Dordrecht 1991, 149 mit zahlreichen Hin
weisen). Dass das Bundesgericht in den jüngsten Entschei
den seine Praxis in Bezug auf die Abgrenzung des interna
tionalen Terrorismus vom legitimen Freiheitskampf
differenzierend weiter entwickelt hat, wird ihm in diesem Be
reich weiterhin Anerkennung bringen.
In der (vorstehend abgedruckten) Erw. 3.8 folgt die im
Ergebnis überzeugende Subsumtion. Demnach bestehen in
casu angesichts des inkriminierten Tötungsdelikts als schwe
res Gewaltverbrechen keine Gründe, um von der genannten
Regel abzuweichen. Angeführt wird zum einen, dass die
fragliche Tat «aus Vergeltung» erfolgt sei, weil der «Dorf
wächter» PKK-Angehörige angezeigt habe. Zum anderen
wird dem Umstand Gewicht zugemessen, dass sich der Be
schwerdeführer über mehrere Jahre an Verbrechen beteiligt
habe, an denen zahlreiche Zivilpersonen zum Opfer gefal
len sein sollen. Es erscheint indessen problematisch, auf
Delikte zu verweisen, die bereits verjährt sind oder mangels
genügend konkreter Sachverhaltsangaben nicht ausliefe
rungsfähig sind. Da es sich bei den bereits verjährten Delik
ten angesichts des fraglichen Zeitraums um weniger schwer
wiegende Delikte gehandelt haben muss, wäre diesbezüglich
die Verhältnismässigkeit anders zu beurteilen. Hinsichtlich
der zweitgenannten Delikte ist zu beachten, dass Angaben,
die nicht genügend konkret sind, um die beidseitige Straf
barkeit zu prüfen, auch keine Schlüsse auf das übrige krimi
nelle Verhalten eines Verfolgten zulassen.
Anders verhält es sich, soweit sich die Erwägungen auf
die gesamten Aktivitäten der PKK im Umfeld des Verfolg
ten beziehen. Es ist nämlich unbestritten, dass der Beschwer
deführer für diese Organisation tätig gewesen ist. Zum da
maligen Zeitpunkt war zwar der Tatbestand der kriminellen
Organisation (260
ter
StGB) noch nicht in Kraft, sodass dies
bezüglich keine beidseitige Strafbarkeit vorlag, wie sie die
Auslieferung voraussetzt. Dies ändert indessen nichts dar
an, dass die inkriminierte Tat im Kontext der übrigen Akti
vitäten zu werten ist. Das BGer verweist auch auf den Um
stand, dass in gewissen Staaten die PKK als terroristische
Vereinigung verboten sei. Es schliesst, dass der fragliche An
schlag als solches auch als Terrorakt zu werten sei (Erw. 3.8).
Anzufügen bleibt, dass diese Bewertung materiell der Pra
xis der ehemaligen Asylrekurskommission (die im Bundes
verwaltungsgericht aufgegangen ist) entspricht, welche bei
einer PKK-Mitgliedschaft unter gewissen Umständen von
Asylunwürdigkeit ausgeht (vgl. EMARK 2002/9, 74 ff.).
III. In Erw. 4 wird geprüft, ob dem Beschwerdeführer als
Kurde in der Türkei eine unmenschliche Behandlung im Sin
ne von Art. 3 EMRK droht, was einer Auslieferung entge
genstünde
(sog. nonrefoulement)
. Das BGer weist die theo
retische Möglichkeit vonMenschenrechtsverletzungen gegen
kurdische Aktivisten, angesichts der u.a. vom europäischen
Folterausschuss dokumentierten Folterfälle in gewissen Ge
bieten, nicht von der Hand. Im vorliegenden Fall erachtet
es indessen aus grundsätzlichen Erwägungen die Gewäh
rung von Rechtshilfe nicht für ausgeschlossen (vgl. Erw. 4.4).
Soweit der Verfolgte nicht Tatsachen glaubhaft machen
konnte, die auf eine konkrete Gefährdung seiner Person hin














