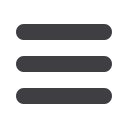

SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 2014
21
ORGANISATION
Wichtig wärs ja schon –
bloss fehlt die Überzeugung
Wissen sichern, klare Abläufe und Verantwortlichkeiten bestimmen. Es spricht
viel dafür, sich mit der eigenen Arbeit auseinander zu setzen. Doch aller Anfang
ist schwer beim Prozessmanagement. Obwohl viele Gemeinden Bedarf orten.
«Ich weiss ja, was ich tue, weshalb soll
ich mir nun überlegen, wie die Prozesse
aussehen?» So oder ähnlich tönt es,
wenn von oben angeordnet wird, dass
man ein Prozessmanagementsystem
aufbauen will. Das ist nicht nur in der
Privatwirtschaft so, sondern auch bei der
öffentlichen Hand. Auch in Zürich (vgl. S.
23) musste Überzeugungsarbeit geleis-
tet werden.
Dabei wäre der Bedarf ausgewiesen, das
hat eine Umfrage der Zürcher Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft
zhaw ergeben. 13 Prozent der insgesamt
rund 1400 angeschriebenen Gemeinden
haben den webbasierten Fragebogen
beantwortet.
Fehlende Ressourcen, fehlende Zeit
Die meisten Gemeinden, die sich an der
Umfrage beteiligt haben, erachten ein
Geschäftsprozessmanagement zwar als
wichtig, fast die Hälfte hat sich aber noch
nicht mit dem Thema auseinanderge-
setzt. Es erstaunt nicht, fehlt in den meis-
ten Gemeinden eine Strategie dafür (vgl.
S. 20). Als Gründe werden meist feh-
lende Ressourcen oder fehlende Zeit
genannt. Diejenigen, die bereits Model-
lierungsprozesse eingeführt haben, ga-
ben als Hauptgrund das Interne Kontroll-
system IKS an, gefolgt von Kostendruck
und Kooperationen oder Fusionen mit
anderen Gemeinden. Qualitätsmanage-
ment oder eine verstärkte Kundenorien-
tierung war bei 20 bzw. 13 Prozent der
befragten Gemeinden ein Grund.
Offenbar nützt aber Druck von oben, im
Kanton St. Gallen war die gesetzliche
Einführung des Internen Kontrollsys-
tems im Jahr 2013 für viele Gemeinden
ausschlaggebend für die Einführung ei-
nes Prozessmanagementsystems in ih-
renVerwaltungen (siehe Kasten). Es gibt
aber auch andere Beispiele: Gemeinden,
die ein solches System von sich aus ein-
geführt haben, beispielsweise Kalt-
brunn. Die 4600-Einwohner-Gemeinde
im Bezirk See-Gaster ist seit 1999
ISO-zertifiziert. Seit dieser Zeit werden
die Prozesse laufend dokumentiert und
wenn nötig optimiert, sagt Esther Gmür,
die das Managementsystem leitet. Der
Gemeindepräsident übernimmt die
Funktion des Managementsystembeauf-
tragten.
Bloss anfänglicherWiderstand
Zu Beginn waren es in Kaltbrunn vor al-
lem die Verwaltungsangestellten, die
dem Prozessmanagement eher skep-
tisch gegenüberstanden und die von den
langfristigen Vorteilen eines solchen
Systems überzeugt werden mussten.
Der Gemeinderat hingegen begrüsste
das Vorhaben von Anfang an. «Unter-
dessen ist es aber eher umgekehrt», sagt
Esther Gmür. Grund dafür sind die Kos-
ten, welche die Anschaffung neuer EDV
und die regelmässigen, externen Audits
mit sich bringen, die vom Zertifizierer
verlangt werden. Pro Jahr zahlt Kalt-
brunn etwa 5800 Franken für das Quali-
tätsmanagement, bei einemUmsatz von
etwa 20 Millionen Franken. Zusätzliche
Ressourcen waren gemäss Esther Gmür
jedoch nicht notwendig. Die Gemeinde
sei vorher schon gut organisiert gewe-
sen, somit habe sich der Dokumentati-
onsaufwand in Grenzen gehalten.
Auch in Gossau, der mit rund 18000 Ein-
wohnern viertgrössten Stadt im Kanton
St. Gallen, bestand die schwierigsteAuf-
gabe darin, dieVerwaltungsangestellten
von den langfristigen Gewinnen eines
solchen Systems zu überzeugen. Zwar
sei man sehr euphorisch in das Projekt
gestartet, die Mitarbeitenden allesamt
mit ins Boot zu holen, sei aber leider
nicht gelungen, sagt Urs Salzmann,
Kommunikationsbeauftragter der Stadt
Gossau. Auch sei das ursprüngliche Ziel,
innerhalb von zwei Jahren alle Prozesse
zu dokumentieren, zu ehrgeizig gewe-











