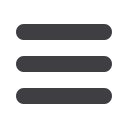

SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 2014
24
ORGANISATION
sie Geeignete aus der Privatwirtschaft
übernommen. Die öffentliche Hand hat
nicht die gleiche Freiheit wie die Privat-
wirtschaft, einzelne Risiken gar nicht ein-
zugehen. Denken Sie an die Feuerwehr:
Diese hat einen öffentlichen Auftrag und
kann nicht sagen, dass ihr ein
Brand zu heiss ist.Wie gesagt
wurde beim Risikomanage-
ment der Chancenaspekt er-
gänzt. Im Gegensatz zur Pri-
vatwirtschaft, bei der das IKS
meist nur auf die korrekte fi-
nanzielle Berichterstattung
ausgerichtet ist, will die Stadt
Zürich mit angemessenen internen Kon-
trollen Fehler und Missbrauch bei allen
wesentlichen Prozessen reduzieren oder
zumindest aufdecken.
Wo waren die grössten
Schwierigkeiten?
Eine Herausforderung liegt in der Grösse
und Vielfalt der Stadtverwaltung Zürich:
Wir sind über 27000 Angestellte, erzie-
len einen Umsatz von über acht Milliar-
den Franken und investieren jährlich
etwa eine Milliarde. Die rund 70 Einhei-
ten wie etwa die Ombudsstelle, das Elek-
trizitätswerk, die Stadtpolizei, die Stadt-
spitäler oder das Schulamt variieren
stark bezüglich ihrer Grösse, der Auto-
nomie, der Standardisierung, externer
Vorgaben oder auch bei der Betriebskul-
tur. Einige konnten auf Bestehendem
aufbauen, bei anderen brauchte es einen
grösseren Aufwand, weil alles neu ge-
schaffen werden musste.
Gab es Ängste?
In einigen Bereichen fürchtete man sich
vor dem Aufwand und machte knappe
Ressourcen geltend. Hier halfen die im
Projekt erarbeiteten Hilfsmittel und auch
die zentrale Unterstützung durch die Fi-
nanzverwaltung. Eine der grössten Her-
ausforderungen – das gilt nicht nur für die
öffentliche Hand – liegt darin, dass Risi-
komanagement und IKS keine Papiertiger
sind, sondern umgesetzt werden. Das ist
ein dauernder Führungsprozess.
Risikobewusstsein kann nicht einfach
von oben verordnet werden.Wie sind
Sie vorgegangen, damit dieser
Kulturwandel wirklich stattfindet?
In der Einführungsphase gab der Sup-
port des zuständigen Stadtrates star-
ken Rückenwind, zum Beispiel an Infor-
mationsveranstaltungen.
Stufengerechte Schulungen
mit illustrativen Beispielen
erleichterten die Einführung.
Bei rund zwei Dritteln der
Organisationseinheiten führt
die Finanzverwaltung einmal
jährlich einen Risikomanage-
mentworkshop mit der Ge-
schäftsleitung durch. Dies
und die Diskussion der Risikopolitik för-
dert das Chancen- und Risikobewusst-
sein.
Ganz amAnfang stehen die Fragen:
Was machen wir überhaupt?Wie se-
hen unsere Prozesse aus?Wie wurde
vermittelt?
Nur wer die Aufgaben und Ziele der Ver-
waltungseinheit kennt, kann beurteilen,
was zu einem Problem werden könnte.
Und nur wer weiss, in welcher Reihen-
folge welche Stellen oder Personen eine
Leistung erbringen, kann den Ablauf
standardisieren, optimieren und ange-
messen kontrollieren. Gerade bei Schnitt-
stellen kann eine gemeinsame Analyse
oft Doppelspurigkeiten reduzieren. Eine
Prozessbeschreibung mit Ablauf inklu-
sive Kontrollen und Zuständigkeiten
schafft Klarheit, erleichtert die Einführung
neuer Mitarbeitender und hilft, wenn je-
mand ausfällt oder etwas schon lange
nicht mehr gemacht hat.
Gab esWiderstand?
Sicherlich fühlen sich einige Personen
infrage gestellt, wenn man nach den Ri-
siken ihrer Tätigkeit fragt. Doch genau
dies belegt die Bedeutung ihrer Arbeit.
Da vieles bereits intern kontrolliert wird,
ist das Analysieren und Dokumentieren
des Bestehenden oft der erste Schritt. Ein
systematischer Ansatz verhindert, dass
man aufVorfälle übertrieben reagiert und
erlaubt es teilweise sogar, die Kontrollen
zu straffen.
Wie beurteilen Sie die Resultate?
«Die Stadt
Zürich will
angemessene
interne
Kontrollen.»











