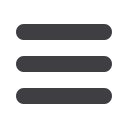

SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 2014
25
ORGANISATION
Die Finanzkontrolle prüft bei der Revision
der einzelnen Einheiten auch deren IKS
und Risikomanagement und kann er-
freulicherweise grösstenteils bestätigen,
dass ein dokumentiertes IKS existiert
und eine Risikobeurteilung vorgenom-
men wurde. Aus meiner Sicht haben
viele Organisationseinheiten den Nutzen
dieser Instrumente erkannt und betrei-
ben sie aus eigenem Interesse auf einem
guten, angemessenen Niveau.
In unserer Versicherungsgesellschaft
besteht die Gefahr, jedes Detail erfas-
sen zu wollen.Wie vermeidet man,
übers Ziel hinauszuschiessen?
Ein wichtiges Stichwort dazu ist dieWe-
sentlichkeit: Es geht um die wesentli-
chen Risiken und auch beim IKS darum,
die wesentlichen, risikobehafteten Pro-
zesse angemessen zu kontrollieren.Wird
zu wenig kontrolliert, kommt schnell die
Frage: Wie konnte so etwas bloss ge-
schehen? Bei einem Zuviel steigt die
Gefahr, dass alles versandet oder ober-
flächlich wird. Es ist eine Gratwande-
rung. Auch wir müssen unsere Ansätze
immer wieder überprüfen und längere
Listen allenfalls sogar straffen. Beim
Chancen- und Risikomanagement mach-
ten wir die Erfahrung, dass nicht die ge-
naue Positionierung auf der Landkarte
entscheidend ist, sondern die Diskussion
zwischen den Verantwortlichen.
In einer Grossstadt gibt es Spezialis-
ten, man kann auf externe Fachleute
zurückgreifen. In einer kleinen
Gemeinde ist das anders, was raten
Sie dem Gemeindepräsidenten, wenn
er dasThema angehen will?
In der Stadt Zürich hat ein Leitungs-
team der Finanzverwaltung zusammen
mit Fachpersonen aus der gesamten
Verwaltung diese Führungsinstru-
mente erarbeitet und eingeführt. Me-
thodisch wurden wir vom Institut für
Verwaltungsmanagement der zhaw be-
gleitet. Daneben hatten wir fast keine
Externen. Dass es nun eine Stelle gibt,
die das Risikomanagement und das IKS
stadtweit koordiniert und dass auch in
jeder Organisationseinheit entspre-
chende Beauftragte ernannt wurden,
erleichtert den Betrieb. Diese Verant-
wortlichen haben daneben jedoch meist
noch viele weitere Aufgaben.
Entsprechend rate ich einer kleinen Ge-
meinde, eine Person zu ernennen, die
sich um dieseThemen kümmert und den
Aufbau sowie die Pflege und
den Einsatz von Risikoma-
nagement und IKS voran-
treibt. In einer ersten Phase
könnte diese Person das
Viele, das bereits besteht,
einmal zusammentragen.
Denn jede Organisation be-
achtet Risiken und führt Kontrollen
durch; die Frage ist bloss, wie weit dies
bloss informell und zufallsgesteuert ist
oder ob es aufs Wesentliche ausgerich-
tet, standardisiert und dokumentiert ist.
Was tun, wenn man hier Verbesse-
rungspotenzial erkennt?
Am wichtigsten erachte ich, dass Exeku-
tive undVerwaltungsführung hinter dem
Ganzen stehen. Weshalb nicht einmal
mit dem Gemeinderat und demVerwal-
tungskader einen Workshop durchfüh-
ren? Wenn ein Überblick über die Ge-
meinde, ihr Umfeld und die wichtigsten
Aufgaben und Ziele erarbeitet wurde,
können die grössten Risiken sowie die
wesentlichen Prozesse abgeleitet wer-
den. In einem nächsten Schritt würde ich
für die grössten Risiken Massnahmen
festlegen und bei einem ersten Prozess
exemplarisch Ablauf und Kontrollen do-
kumentieren. Auf Basis dieser ersten
Erfahrung und dieses Prototyps kann
dann diskutiert werden, wie Risikoma-
nagement und IKS ausgestaltet sein sol-
len. In diesem Rahmen ist auch festzule-
gen, wie die Gemeinde mit Risiken
umgehen will. Wichtiger als die genaue
Methode erscheint mir, dass man damit
beginnt!
Hat die Stadt Zürich jetzt alle
Risiken unter Kontrolle?
Keine Organisation hat alles unter Kon-
trolle. Erstens gibt es immer Risiken, die
man gar nicht beeinflussen kann, den-
ken Sie an ein Erdbeben. Zweitens sind
wir alle
Menschen:Wirübersehen man-
ches – Sie wissen, dass wir Europäer
immer davon ausgegangen sind, dass
es keine schwarzen Schwäne gibt – bis
sie in Australien entdeckt wurden. Und
niemand hat die Garantie, dass er Ein-
trittswahrscheinlichkeit und Auswirkun-
gen richtig einschätzt oder dass er die
richtigen Massnahmen eingeleitet hat.
Drittens kann dieTechnik ver-
sagen.Viertens kann fast jede
Kontrolle vergessen gehen
oder umgangen werden,
wenn zwei oder mehrere be-
trügerisch zusammenarbei-
ten. Fünftens wäre es zu auf-
wändig und zu teuer, alles
kontrollieren zu wollen.Wir wollen keine
absolute, sondern eine angemessene
Sicherheit. Sechstens wäre es lähmend,
alle Risiken auszuschliessen; die Stadt
Zürich will kalkulierte Risiken eingehen.
Chancen zu nutzen, geht nicht, ohne
auch Risiken einzugehen.
Und wie lautet Ihr Fazit?
Insgesamt will die Stadt Zürich ihre
Aufgaben sicher, effizient und ord-
nungsgemäss erfüllen. Das Chancen-
und Risikomanagement sowie das In-
terne Kontrollsystem leisten dazu
wichtige Beiträge. Selbstverständlich
kann man nicht belegen, welche Schä-
den dadurch vermieden wurden. Doch
wir sind überzeugt, dass sich diese In-
vestition gelohnt hat und weiterhin
lohnt.
Interview: Peter Camenzind
Infos:
www. tinyurl.com/prbwmmr
www. tinyurl.com/nzr6xbh
«Es geht
um die
wesentlichen
Risiken und
Prozesse»
Dr. Markus
Braunschweiler
ist Projektleiter in
der Finanzverwal-
tung der Stadt
Zürich und leitet
das IKS-Kompetenz-
zentrum.
Anzeige











