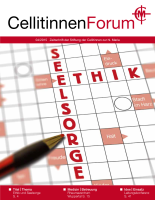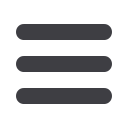

Laura M. wird mit 35 Kilogramm
Körpergewicht ins St. Vinzenz-
Hospital eingewiesen. Die 24-Jäh-
rige leidet an Magersucht. Eine
Zwangsernährung lehnt sie ab.
Jonas L., 45, wird schwer verletzt
nach einem Unfall ins Wuppertaler
Petrus-Krankenhaus eingeliefert. Er
muss operiert werden und benötigt
eine Bluttransfusion. Aus religiösen
Gründen lehnen seine Angehörigen
diese ab. Im Seniorenhaus Burg
Ranzow in Kleve liegt die 89-jäh-
rige Helga S. im Sterben. Wasser
in der Lunge setzt ihr arg zu. In
einer Patientenverfügung hat sie
lebensverlängernde Maßnahmen
abgelehnt, ohne über die Möglich-
keiten einer palliativen Begleitung
informiert zu sein.
Wie weit geht die Patientenautono-
mie? Was ist zu tun, wenn der Pa-
tient sich nicht mehr selbst äußern
kann? Täglich werden Mitarbeiter in
Kranken- und Seniorenhäusern mit
dieser Frage konfrontiert. Sie müs-
sen herausfinden, wie der Patient
oder der Bewohner entscheiden
würde, wenn es keine Aussicht
auf Besserung des Krankheitsver-
laufs mehr gibt: lebensverlängern-
de Maßnahme oder Abbruch der
Therapie. Hilfreich sind Patienten-
verfügungen, doch in vielen Fällen
sind diese in der jeweiligen Situa-
tion zu interpretieren. Ein einzelner
Mensch, egal ob Arzt, Angehöriger
oder Pflegeleitung, wäre überfor-
dert, müsste er diese Entscheidung
für einen Dritten alleine fällen. An
dieser Stelle sind viele Perspektiven
gefordert.
Der Patientenwille ist bindend
In schwierigen Situationen helfen
die Ethikkomitees und die Ethik-
teams. In den Krankenhäusern des
Cellitinnenverbundes gibt es ein
übergeordnetes Ethikkomitee. Vier
Mal im Jahr und zu einer Klausurta-
gung kommen Vertreter der Ethik-
teams aus den sechs Cellitinnen-
Krankenhäusern, ein Vertreter der
Geschäftsführungen, ein Jurist, ein
katholischer und ein evangelischer
Seelsorger unter dem Vorsitz der
Ethikreferentin Dr. Sylvia Klauser
zusammen. Das Ethikkomitee hat
die Aufgabe, hausübergreifend
ethische Handlungsempfehlungen
zu verfassen, beispielsweise zum
Umgang mit Patientenverfügungen.
Es gestaltet Fortbildungskurse in
den Häusern für interessierte Mit-
arbeiter sowie die Ethikteams und
koordiniert deren Arbeit in den Kli-
niken.
Die Zahl der regelmäßigen Treffen
der Ethikteams ist von Haus zu
Haus unterschiedlich. Die Teams
setzen sich aus verschiedenen Be-
rufsgruppen, Ärzten, Kranken- und
Gesundheitspflegern, Mitarbeitern
des Sozialdienstes, Seelsorgern
und Physiotherapeuten zusammen.
Sind Patienten schwerstkrank und
ohne eine Aussicht auf Besserung,
können die Ethikteams der Kliniken
von Mitarbeitern, Patienten oder
den Angehörigen beauftragt wer-
den, ein ‚ethisches Konsil‘ durch-
zuführen. Dabei wird sachlich und
unter Berücksichtigung aller medizi-
nischer, biografischer und sons-
tiger Aspekte versucht, den Willen
des Patienten in der besonderen
Situation herauszufinden. Auch
die Angaben in einer Patienten-
verfügung müssen auf die aktuelle
Situation bezogen werden. „Steht
dort drin, dass der Patient nicht
künstlich beatmet werden möchte,
gehen wir davon aus, dass dabei
eine dauerhafte künstliche Beat-
mung gemeint ist, nicht eine kurz-
zeitige nach einer Operation“, so
Dr. Klauser. „Wenn wir gemeinsam
zu dem Schluss kommen, dass der
Patient eine weiterführende Thera-
pie unter der gegebenen Prognose
nicht wünscht, ist es möglich, das
Therapieziel zu begrenzen. Dann
liegt unser Schwerpunkt darauf,
In Grenzsituationen entscheiden
Ethikkomitees und Ethikteams im Kranken- und Seniorenhaus
6
CellitinnenForum 4/2015
Titel | Thema