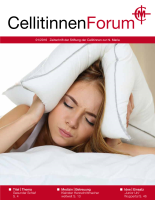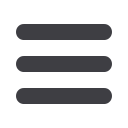

CellitinnenForum 1/2016
33
Kirche Überlieferungen zweier ‚hei-
liger Sophien‘, die später – jedenfalls
teilweise – in einer Person gleich-
gesetzt werden. Die üblicherweise
als ‚von Rom‘ bezeichnete Sophia,
die ‚Eisheilige‘, gilt als Märtyrerin
der diokletianischen Christenver-
folgung um das Jahr 300. Sehr viel
mehr, als dass sie zu einer Grup-
pe von Märtyrern gehörte und auf
einer frühchristlichen Begräbnis-
stätte bestattet wurde, geben die
wenigen, dem siebten und achten
Jahrhundert angehörenden Quellen
nicht her. In der Zeit Karls des Gro-
ßen, frühestens aber 772, erhielt
der Straßburger Bischof Remigius
von Papst Hadrian I. Reliquien die-
ser Sophia zur Ausstattung des von
ihm um das Jahr 770 gegründeten
Klosters in Eschau
unweit von Straß-
burg. Nach Zer-
störung und Wie-
deraufbau des Klosters im zehnten
Jahrhundert entwickelte sich dort
ein Zentrum der Sophia-Verehrung
im Mittelalter, was die Errichtung
eines Pilgerhospizes am Ort be-
legt. In der Kirche befindet sich bis
heute ein Schrein mit Knochen-
überresten der Märtyrerin. Darü-
ber hängt eine Holzskulptur aus
dem 15. Jahrhundert: Sophia als
zeitgenössische Matrone mit einer
aufwendigen Kopfhaube und aus-
ladendem Mantel bekleidet. Davor
stehen drei Mädchenfiguren mit
kunstvollen Haartrachten.
Fides, Spes, Caritas
Diese Figurengruppe weist eigent-
lich auf eine zweite Sophia hin, die
‚von Mailand‘. Der Ort ihrer Be-
stattung, ebenfalls in Rom, ist in
einem Verzeichnis von Märtyrer-
gräbern des siebten Jahrhunderts
erwähnt, zusammen mit dem ihrer
drei Töchter, die in griechischer
Sprache offensichtlich nach den
drei göttlichen Tugenden benannt
sind als: Pistis (lat. Fides = Glau-
ben), Elpis (lat. Spes = Hoffnung)
und Agape (lat. Caritas =
Liebe). Die legendäre
Leidensgeschichte
lässt diese Sophia
als Witwe während
der Regierungszeit des Kaisers
Hadrian (117 – 138) mit den drei
Töchtern von Mailand nach Rom
kommen. Die drei Mädchen imAlter
von zwölf, zehn und neun Jahren
werden wegen ihres christlichen
Glaubens gefangen genommen,
gefoltert und getötet. Die Mutter
habe dem grausamen Mord zu-
sehen müssen, ein schreckliches
‚geistliches Martyrium‘. Drei Tage
später sei Sophia dann eines na-
türlichen Todes gestorben.
Vergleichbare Inschriften an Grä-
bern in römischen Katakomben
deuten darauf hin, dass die Namen
der Töchter eher als eine Deutung
zu verstehen sind und den sehr na-
heliegenden Zusammenhang von
Sophia (=Weisheit) und eben den
Tugenden von Glaube, Hoffnung
und Liebe ausdrücken. Im achten
Jahrhundert ist in Rom die kultische
Verehrung von Mutter und Töchtern
belegt. Ältere liturgische Kalender
verzeichneten sowohl einen Ge-
denktag für die ganze Gruppe am
ersten August als auch zwei ver-
schiedene Termine für die Töchter
am ersten August und für Sophia
am 30. September.
Die Verehrung der drei jungfräu-
lichen Märtyrerinnen Fides, Spes
und Caritas hat auch im Rheinland
einen nach wie vor besonderen
Ort, einen Turm auf dem Swister-
berg bei Weilerswist. Er ist Überrest
einer Kirche, in der sich seit der
Reformationszeit eine beliebte Wall-
fahrt zu den ,Drei Heiligen Jung-
frauen‘ entwickelte. Deren Abbild,
entstanden in der Barockzeit, kam
1976/78 in die Weilerswister Pfarr-
kirche St. Mauritius. Vielleicht ist es
die Vielfalt der Anliegen und Nöte,
bei denen die drei Jungfrauen an-
gerufen werden können, die Men-
schen auch bis heute zum Swister
Turm führt. So sind es Krankheit,
Hunger und Krieg, aber auch die
Sorge um Fruchtbarkeit und um
eine gute Ernte sowie die Bitte um
geistliches Wachstum in Glaube,
Liebe und Hoffnung.
Wolfgang Allhorn
Caritas
Glauben | Leben