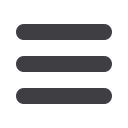

Vom Mittelalter bis ins 17. Jahr-
hundert hinein lebten in den euro-
päischen Gesellschaften rund acht
bis zehn Prozent über Sechzigjähri-
ge. Die in den Geschichtsbüchern
angegebene durchschnittliche Le-
benserwartung von maximal 35
Jahren für jene Zeit – die Statis-
tiken schwanken je nach Quellen-
grundlage – ist irreführend, denn
sie beinhaltet die damals hohe
Kindersterblichkeit. Schätzungen
zufolge starben rund 50 Prozent der
Menschen vor Erreichen der Puber-
tät. Wer diese Zeit überlebte, hatte
durchaus Chancen, je nach gesell-
schaftlichem Stand, das sechzigste
Lebensjahr oder mehr zu erreichen.
Zwar prägte auch im Mittelalter die
Erscheinung das Alter und nicht
die erreichten Lebensjahre, doch
im Allgemeinen galten Männer mit
spätestens 60 Jahren als alt, Frau-
en mit Erreichen der Menopause.
Aber das war für unsere Vorfahren
noch lange kein Grund, sich zur
Ruhe zu setzen. In der Regel arbei-
teten sie, egal welcher Schicht und
welchem Beruf sie angehörten, so
lange wie möglich – die meisten
hätten auch keine andere Wahl
gehabt. Verlierer der Gesellschaft
waren arme Lohnabhängige, be-
sonders alleinstehende alte Frauen.
Sie hatten nichts ‚auf der hohen
Kante‘ und mussten widrigenfalls
betteln gehen. Bessergestellte wie
Kaufleute, Handwerker und Notare
sorgten für ihr Alter vor.
Alter als ‚Restzeit‘
Das romantische Bild der Groß-
familie, in der die Jungen für die
Alten sorgten, war in Nord- und
Mitteleuropa eher die Ausnahme,
zumal in den Städten. Die ältere Ge-
neration, sofern sie das ‚gesegnete‘
Alter erreichte, versuchte, so lange
wie möglich im eigenen Haushalt zu
leben. Sie konnte sich auch nicht
auf die Unterstützung ihrer Kinder
verlassen, weil diese selbst arm,
vor ihnen gestorben oder längst
aus der Stadt oder dem Dorf weg-
gezogen waren. Altersarmut und –
einsamkeit sind keine neuzeitlichen
Probleme. Abhängig zu sein von
der Familie war nie eine gute Op-
tion für die Generation 65plus. Ge-
sundheit, finanzielle Sicherheit und
Eigenständigkeit waren und sind
die Themen des Alters.
Erwartungen
Gemeinhin erwarteten die europäi-
schen Gesellschaften des Mittel-
alters und der Renaissance von
ihrer älteren Generation, dass sie
ihre Gebrechen klaglos erdulde-
te, ihren Frieden mit Gott mach-
te und möglichst zurückgezogen
lebte. Die Menschen reduzierten
das Alter auf die Gebrechen. Der
verwelkende Körper stand in der
Kunst für Vergänglichkeit, sinnlose
Eitelkeiten und die Sünde. In der
Renaissance, in der die Schönheit
zum Ideal erhoben wurde, war für
die zweite Hälfte des Lebens be-
sonders wenig Platz. Wer es sich
leisten konnte, versuchte die Falten
hinter Schmuck und Schminke zu
verstecken – und erntete für das
Bemühen nicht selten Hohn und
Spott.
Im Wandel der Zeit
Wie unsere Vorfahren alt wurden
8
Titel | Thema
CellitinnenForum 4/2018
















